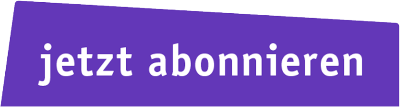Das Phänomen des Landgrabbings nimmt weltweit zu – nicht nur im globalen Süden, sondern auch in Deutschland, besonders in Ostdeutschland. Eine Untersuchung zur Landkonzentration im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg zeigt, wie kapitalstarke Investoren die Kontrolle über immer größere Agrarflächen gewinnen. Die Entwicklung gefährdet die bäuerliche Selbstbestimmung und die Ernährungssouveränität der Region. Um dem Konzentrationsprozess entgegenzuwirken, ist eine gerechtere Landpolitik notwendig. Diese sollte eine nachhaltige Landwirtschaft und eine regionale Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen.
Der Begriff Landgrabbing beschreibt die großflächige Aneignung von Land durch kapitalstarke Investor*innen, welche die Konzentration von Land in wenigen Händen sowie eine Veränderung der Landnutzung mit sich bringt. Häufig wird Landgrabbing von Menschenrechtsverletzungen begleitet, indem Menschen von ihrem Land verdrängt werden und ihre Lebensgrundlage genommen wird.
Landgrabbing tritt allerdings nicht exklusiv im globalen Süden auf, sondern auch zum Beispiel in Ostdeutschland. Während das Phänomen hier nicht von Menschenrechtsverletzungen begleitet wird, führt die Entwicklung jedoch zu einer enormen Konzentration von Land in wenigen Händen. Neben dem allgemeinen Interesse an Land als Wertanlage werden Flächen dabei zunehmend für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien nachgefragt. Auf Grund des gesetzlichen Vorkaufsrechts für Landwirt*innen ist ein Landkauf in großem Stil zwar nur möglich, wenn der Investor zunächst einen landwirtschaftlichen Betrieb erwirbt. Diese sogenannten Share Deals sind jedoch ohne jegliche Einschränkung möglich und müssen nicht gemeldet werden.
Die besondere landwirtschaftliche Struktur macht Ostdeutschland besonders attraktiv für Investitionen in Land. Der ländliche Raum dort ist von einer
großstrukturierten Landwirtschaft geprägt. Anders als in Westdeutschland sind viele landwirtschaftliche Betriebe nicht in Familienbesitz, sondern in Form von Unternehmen organisiert (zum Beispiel GmbH und Genossenschaft). Zudem liegen die Bodenpreise – trotz eines starken Anstiegs – noch immer unter dem Westniveau.
„15 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche werden von Investor*innen bewirtschaftet.“
Untersuchung im Landkreis Elbe-Elster
Für meine Masterarbeit habe ich die zunehmende Landkonzentration im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster untersucht. In dieser Region wird etwa die Hälfte der Fläche (88.636 Hektar) von insgesamt 364 Betrieben landwirtschaftlich genutzt. Mittels 19 Interviews in der Landwirtschaft, dem Agrarhandel und mit weiteren relevanten Akteur*innen habe ich die Perspektiven vor Ort erfasst. Zudem führte ich eine quantitative Analyse der Eigentumsstrukturen landwirtschaftlicher Betriebe und von Solarflächen durch.
Die Ergebnisse zeigen eine hohe Landkonzentration: 22 Holdings, bestehend aus 63 Einzelbetrieben, kontrollieren 57 Prozent des landwirtschaftlich genutzten Landes. Holdings stellen eine besondere Eigentumsform dar, bei der einzelne Betriebe zwar formal als separate Einheiten bestehen, aber gemeinsam verwaltet werden und damit die tatsächliche Landkonzentration verschleiern. Diese Form von Besitzkonsolidierung macht die Übernahme großer Betriebe leichter. Im Einzelnen haben sich dabei drei zentrale Mechanismen herauskristallisiert:
Betriebsübernahmen
15,42 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Elbe-Elster werden von Investor*innen bewirtschaftet. In meiner Arbeit definiere ich diese als in anderen Branchen als der Landwirtschaft tätig und/oder als überregional aktiv. Die Investor*innen in Elbe-Elster stammen aus unterschiedlichsten Branchen und sind regional, national oder international tätig. Während einige Betriebe schlecht gemanagt und schnell wieder verkauft werden, gibt es zwischen den meisten Betrieben im Besitz von Investor*innen und Familienbetrieben kaum Unterschiede. Investor*innen haben jedoch meist besseren Zugang zu Kapital, was ihnen einen Vorteil im Wettbewerb um Land verschafft. Außerdem sind sie oftmals besser in der Lage, eigenständig Solarprojekte umzusetzen oder profitable Verträge mit Stromanbietern auszuhandeln.
Solarparks und „Goldrausch“-Atmosphäre
In den Interviews wird von einer massiven Nachfrage nach Solarflächen berichtet, einem regelrechten „Goldrausch“. Für Solarparks pachten Investor*innen auch landwirtschaftliche Flächen, was die Pachtpreise in die Höhe treibt und landwirtschaftliche Betriebe unter Druck setzt.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Landwirt*innen in Ostdeutschland mehr als zwei Drittel ihrer Flächen pachten. Während der Pachtpreis für landwirtschaftliche Nutzflächen im Landkreis Elbe-Elster bei 116 € pro Hektar liegt, bieten Solarunternehmen zwischen 3.000 und 4.000 € pro Hektar. Viele Landwirt*innen können die hohen Pachtpreise nicht zahlen und verlieren ihre Flächen an die Solarindustrie. Selbst wenn Landwirt*innen von den Pachteinnahmen profitieren, sind sie meist nicht direkt am Gewinn beteiligt (keiner der 39 Besitzer*innen von Solarparks in Elbe-Elster ist Landwirt). 70 Prozent der Solaranlagen sind zudem in westdeutschem Besitz. Dies zeigt, dass die Gewinne des Solarbooms selten in der Region verbleiben.
Freiflächenanlagen für Photovoltaik sind mittlerweile ein zentraler Beweggrund, landwirtschaftliche Betriebe zu kaufen. Ein aktuelles Beispiel: Die Quarterback Immobilien AG hat ungefähr zeitgleich mit dem Kauf eines Betriebs in Elbe-Elster die Quarterback Energy GmbH gegründet, die mit einem Kredit von 125 Millionen Euro der Deutschen Bank Freiflächenanlagen bauen will.
„70 Prozent der Solaranlagen sind in westdeutschem Besitz.“
Druck durch Verpächter*innen
In den Interviews wurde wiederholt berichtet, dass Verpächter Landwirt*innen drohen, Splitterflächen an andere zu verpachten, falls nicht sehr hohe Pachtpreise gezahlt werden. Landwirt*innen riskieren dadurch, kleine Flächen inmitten eines großen Feldes zu verlieren, was die Bewirtschaftung erheblich erschwert.
Zudem wird Land oft an Nichtlandwirt*innen verkauft. Zwar besteht ein Vorkaufsrecht für Landwirte, diese können aber die hohen Preise oft nicht aufbringen oder nicht nachweisen, dass sie auf das Land angewiesen sind. Diese Problematik hat bisher wenig Aufmerksamkeit erhalten, hat aufgrund der Vielzahl kleiner Transaktionen jedoch eine erhebliche kumulative Wirkung.
Empfehlungen für eine gerechtere Landpolitik
Die Landwirtschaft in Ostdeutschland ist durch Bürokratie, Fachkräftemangel, hohe Investitionen und zunehmenden Wettbewerb um Land geprägt. Diese Herausforderungen führen zu weiterer Landkonzentration, da sich viele Landwirt*innen gezwungen sehen, mit Investoren zu kooperieren, um ihren Betrieb zu sichern. Aus diesem Grund sind viele landwirtschaftliche Betriebe mittlerweile auch offener für zusätzliche Einkommensmöglichkeiten, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien.
Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass die Landkonzentration in Ostdeutschland zu einer Änderung der Besitzverhältnisse führt – insbesondere zu Gunsten großer Holdings und externer Investor*innen. Des Weiteren verändert sich die Landnutzung, da immer mehr Freiflächenanlagen gebaut werden. Dies ist vor allem problematisch, da die Landwirt*innen nicht an den Energieprojekten beteiligt werden. Um die bäuerliche Selbstbestimmung zu sichern und die regionale Ernährungssouveränität zu schützen, werden daher Maßnahmen zur Preisregulierung und zur Förderung der lokalen Landwirtschaft benötigt.
Dringend notwendig ist ein rechtlicher Rahmen, der es Landwirt*innen ermöglicht, ihre Betriebe nachhaltig und unabhängig von den Interessen der Finanzmärkte zu führen. Auf Landesebene gab es in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg bereits einige erfolglose Versuche, Share Deals zu regulieren.
Neben der Regulierung des Bodenmarktes spielt der Ausbau erneuerbarer Energien eine zentrale Rolle. Dieser sollte stärker an regionalen Bedarfen und Beteiligungsmöglichkeiten ausgerichtet sein, damit die Gewinne und Vorteile der Solarprojekte den betroffenen Gemeinden zugute kommen. So könnte der ländliche Raum in Ostdeutschland langfristig ökologisch und ökonomisch gestärkt werden.
von Annalena Herrmann
Annalena Herrmann hat in Lund, Schweden ihren Master in International Development and Management absolviert. Davor hat sie in Amsterdam Politikwissenschaften studiert. Der Artikel fasst die Ergebnisse ihrer Masterarbeit zusammen. Die vollständige Arbeit online: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9169057