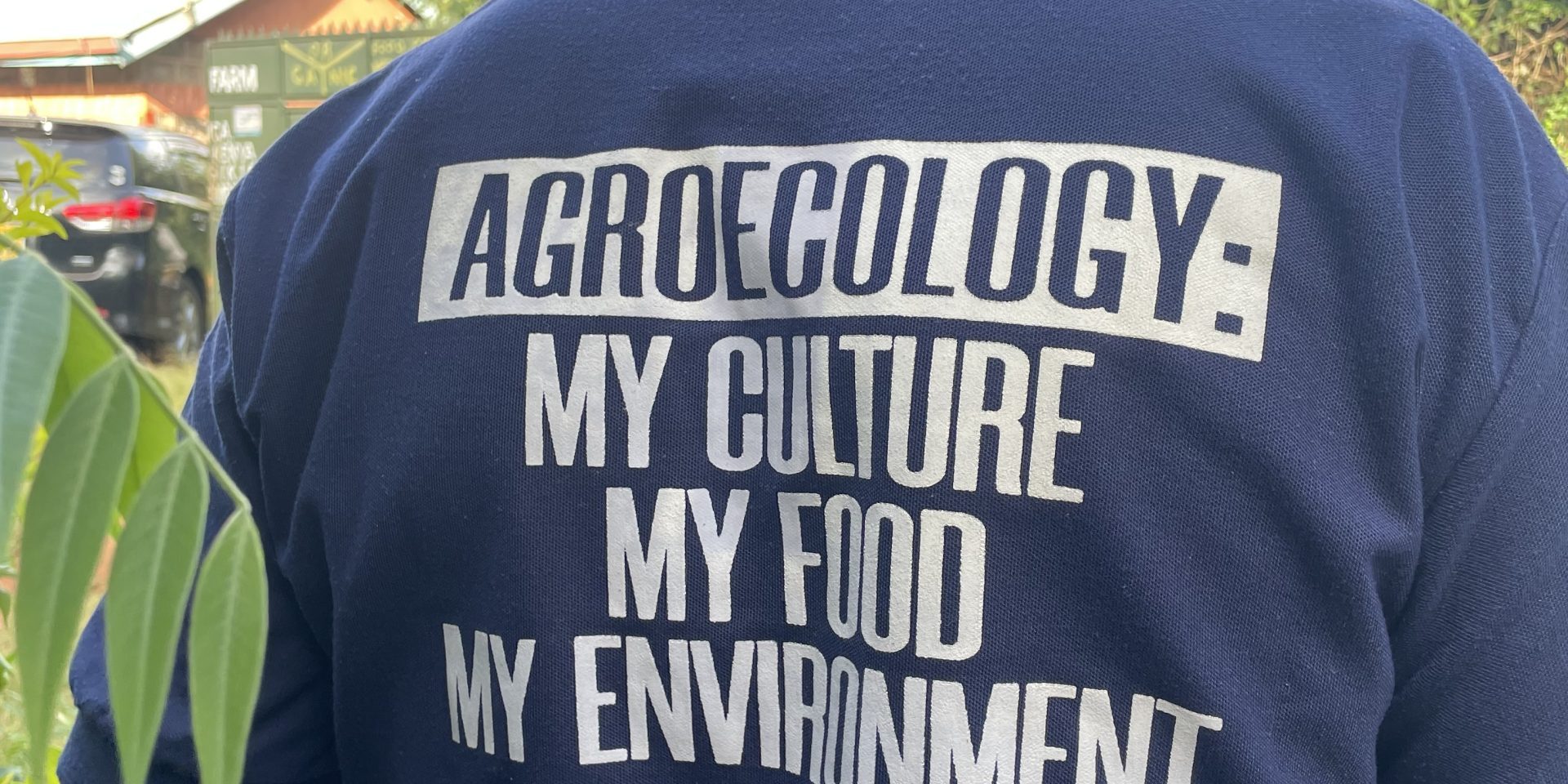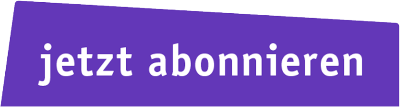Agrarökologie ist in erster Linie Praxis und soziale Bewegung. Sie vereint ökologische Prinzipien mit sozialer Gerechtigkeit und steht für eine Selbstermächtigung von unten nach oben. Das Recht auf Nahrung ist ein völkerrechtlich verbrieftes Menschenrecht. Es verpflichtet Staaten zur Umsetzung. Die größte Kraft für die Bekämpfung von Hunger und Ernährungsarmut entfalten die beiden Konzepte, wenn sie miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Erfolgreich hat die Zivilgesellschaft das Schlagwort Agrarökologie in den Diskurs bis in die Regierungsebene hinein gesetzt. Doch was ist Agrarökologie eigentlich? Worin liegt der Unterschied zum Ökolandbau? Warum ist das Konzept weltweit so wichtig für soziale Bewegungen? Und in welchem Verhältnis steht es zum Recht auf Nahrung?
Agrarökologie: Ein Geschichts-Crashkurs
Die Wurzeln der Agrarökologie als Bewegung liegen im kollektiven Widerstand gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft. Ab den späten 1950er Jahren wurde das Konzept der Grünen Revolution durch den Globalen Norden mit großem Aufwand weltweit verbreitet. In Kooperation mit Agrarkonzernen und mächtigen Geldgebern wie der Rockefeller- und Ford-Stiftung trieben insbesondere die USA den massiven Einsatz von Industriesaatgut, -düngemitteln und -pestiziden voran. Um sich diese Betriebsmittel leisten zu können, verschuldeten sich Bäuer*innen überall auf der Welt. Ausgelaugte Böden, die Abhängigkeit von Chemikalien und eine nicht endende Spirale der Verschuldung treibt auch heute noch jeden Tag Bäuer*innen dazu, sich das Leben zu nehmen.
Die Agrarökologie ist die weltweite Erfolgsgeschichte derjenigen, die sich gegen dieses System behaupteten. Eines der ersten Beispiele war die Campesino a Campesino Bewegung aus Guatemala. Als Reaktion auf den immer fester werdenden Griff der Agrarindustrie organisierten sich in den frühen 1970er Jahren Kaqchikel Maya, um traditionelle Praktiken wiederzubeleben. Sie errichteten Demonstrationsbeete und teilten neue Erkenntnisse miteinander. Dazu gehörte die Herstellung ökologischer Düngemittel und die Diversifizierung des Anbaus durch alte Sorten. Die Erträge stiegen, Gewinne erhöhten sich. Dadurch gelang es den Kaqchikel, verloren gegangenes Land zurückzukaufen und untereinander aufzuteilen. Aufgrund staatlicher Repression flüchteten viele von ihnen in andere Länder Mittelamerikas, wo sie ihre Bewegung verbreiteten. Ihre Organisationsfähigkeit und selbstermächtigende Pädagogik machen die Bewegung heute zum lebendigen Sinnbild für eine andere Art des Zusammenlebens.
Die unbequeme Vielfältigkeit der Agrarökologie
In allen Regionen der Welt finden sich Beispiele für Agrarökologie: Schulgärten in Uganda, durch die junge Menschen traditionelle Lebensmittel erhalten; Eco-Swaraj-Gemeinschaften in Indien, in denen Frauen durch Selbsthilfegruppen traditionelle Saatgutsorten wiedereingeführt und ihre Rolle in lokalen Entscheidungsprozessen gestärkt haben; oder solidarische Landwirtschaft, genossenschaftliche Supermärkte und Ernährungsräte, zum Beispiel in Brasilien oder Europa.
Wir halten also fest: Ja, bei der Agrarökologie geht es darum, von einer chemisch industriellen Landwirtschaft zu einer Nahrungsproduktion zu kommen, die auf ökologischen und lokalen Kreisläufen basiert. Aber es geht um noch viel mehr: um soziale Gerechtigkeit und Teilhabe; um ökologische, wirtschaftliche, kulturelle und politische Innovation; darum, wie Menschen sich auf verschiedenste Weise selbstbestimmt organisieren, um sich und andere mit gesunder Nahrung zu versorgen. Mit anderen Worten: Agrarökologie ist ein gelebtes Konzept, wie wir gemeinsam unsere Ernährungssysteme von unten nach oben umgestalten können, um lokal und global Machtungleichheiten auszugleichen und gerechtere Systeme menschlichen Zusammenlebens zu schaffen.

Agrarökologie ist mehr als „nur“ Öko
Agrarökologie und Recht auf Nahrung finden zueinander…
In den 1980er und 90er Jahren nahmen immer mehr soziale Bewegungen Agrarökologie als zentrales Konzept an. Staaten waren dabei eher Hindernis als Beförderer. Ein allmähliches Umdenken kam erst mit der Welternährungskrise 2008, als der Weltagrarbericht (IAASTDD) unter starken agrarökologischen Bezügen wissenschaftlich klar machte, dass ein weiter-so keine Option sein würde.
Darauf aufbauend setzte Olivier de Schutter, ex-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, mit seinem Bericht für den UN-Menschenrechtsrat 2010 einen Meilenstein für die Integration von Agrarökologie und dem Recht auf Nahrung. Er belegte, dass agrarökologische Ansätze die Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln in vielen Erdregionen gegenüber der konventionellen Landwirtschaft stark verbessert haben. Und weil das Recht auf Nahrung Staaten dazu verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, dass ihre Bürger*innen sich angemessen ernähren können, ergab sich für de Schutter eine klare menschenrechtliche Schlussfolgerung: Die Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Agrarökologie gehört zu den staatlichen Pflichten in Bezug auf das Recht auf Nahrung.
… und kommen zusammen
Der Bericht gab der Agrarökologie auf UN-Ebene starken Aufwind und kulminierte 2018 in der Veröffentlichung der 13 gemeinsamen Prinzipien der Agrarökologie durch das Expert*innengremium des Welternährungsausschuss (CFS). Im gleichen Jahr wurde Agrarökologie durch die 10 Elemente der FAO in den Vereinten Nationen verankert. In diesen zeigt sich die Harmonie zwischen Agrarökologie und dem Recht auf Nahrung. Denn einige ihrer wichtigsten Prinzipien haben die beiden Konzepte gemeinsam. Dazu gehören vor allem der Zugang zu natürlichen Ressourcen wie Land, Wasser und Saatgut für diejenigen, die von der Nahrungsmittelproduktion leben, sowie die Teilhabe in Entscheidungsprozessen. Seit 2018 wird Agrarökologie stets in die Beschlüsse des CFS integriert.
2018 markiert auch das Jahr eines zweiten wichtigen Ereignisses: Die Verabschiedung der UN-Kleinbäuer*innenerklärung UNDROP. Diese basiert auf dem Recht auf Nahrung und wurde nach 17 Jahren Verhandlungen durch soziale Bewegungen erstritten. Sie ist das erste UN-Instrument, das völkerrechtlich festhält, was De Schutter 2010 für die Staatenpflichten schlussfolgerte. Damit ist die UNDROP völkerrechtliche Grundlage und gleichzeitig Mittel der agrarökologischen, rechtebasierten Transformation unserer Ernährungssysteme.
Brasilien macht’s vor!
Mit der ersten Präsidentschaft von Lula da Silva begann 2003 ein neues Zeitalter der Ernährungspolitik. Bezüglich des Prinzips der sozialen Teilhabe gehörte die Wiedereinführung und Stärkung des nationalen Ernährungsrats CONSEA zu den wichtigsten Maßnahmen. Der CONSEA ist heute das wichtigste Beratungsgremium des Präsidialbüros zu Ernährungsfragen und besteht zu zwei Dritteln aus Delegierten der Zivilgesellschaft und zu einem Drittel aus Regierungsvertreter*innen. Der Ernährungsrat agiert auf lokalem, regionalem sowie nationalem Level und ist Brasiliens wichtigster Treiber rechtebasierter Politikansätze.
Zu den Paradebeispielen der Umsetzung des Rechts auf Nahrung bei gleichzeitiger Stärkung der Agrarökologie zählen die Programme der öffentlichen Nahrungsmittelbeschaffung, die vom CONSEA eingefordert wurden. Durch die Programme erwirbt der Staat Nahrungsmittel von agrarökologisch ausgerichteten Kleinbetrieben und verteilt diese mittels sozialer Einrichtungen und staatlicher Institutionen wie Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das Schulverpflegungsprogramm verpflichtet Kommunen, mindestens 30 Prozent der vom Staat zur Verfügung gestellten Mittel für die Nahrungsbeschaffung von Kleinbetrieben einzusetzen. Darüber hinaus erhalten alle Schüler*innen ein kostenloses Mittagessen. Durch diesen Hebel der Gemeinschaftsverpflegung schaffte Brasilien es, die Hungerzahlen drastisch zu senken und dabei gleichzeitig die Einkommen vieler Kleinbäuer*innen, die von der Abnahmegarantie profitieren, zu erhöhen.

Campesinos: Kaqchikel Maya aus Guatemala schufen die Campesino a Campesino Bewegung (©Steve Richards, CC BY 2.0)
Zum Welternährungstag im Oktober 2024 führte die Regierung ein weiteres Programm ein: Den Nationalen Plan „Essen auf dem Teller“ (PLANAAB). Dessen Grundprinzipien sind das Recht auf Nahrung, Ernährungssouveränität und die agrarökologische Transformation. Vorgesehen sind beispielsweise die Anzahl lokaler Märkte zu erhöhen, Agroforstsysteme auszubauen, traditionelle Saatgutsysteme zu stärken und die Fläche für den Anbau von Grundnahrungsmitteln durch Kleinbäuer*innen zu vergrößern.
Die vielfältigen Beispiele aus aller Welt führen uns vor Augen, dass Agrarökologie etwas ist, von dem wir alle ein Teil werden können. Und: Basierend auf dem Völkerrecht können wir vom Staat einfordern, dass er uns dabei den Rücken stärkt. Brasilien zeigt, wie das funktionieren kann. Zeit, dass die anderen Staaten nachziehen! Der agrarpolitische Dialog zwischen Brasilien und Deutschland ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Von Jan Dreier und Stig Tanzmann. Jan Dreier ist Referent für das Recht auf Nahrung bei FIAN Deutschland. Stig Tanzmann ist Referent für Landwirtschaft bei Brot für die Welt.